In der Regel werden auf den höheren Bändern entweder Yagi-Antennen oder
Parabolspiegel eingesetzt. Diese liefern entsprechenden hohen Gewinn.
Der Selbstbau von Yagiantennen in dem Bereich stösst jedoch auf mehrer
Probleme, die Anforderungen an die Genauigkeit der einzelne Elemente werden
mit abnehmender Wellenlänge immer größer, der Boom (Träger) beeinflußt immer
mehr die Charakteristik der Antenne und die Anpassungschaltung wird immer
filigraner, außerdem darf der Mast nicht durch die Antenne reichen.
Vormastyagis verursachen an ultraleichten Antennenmasten ein entsprechendes
Kippmoment, ein Unterzug bedeutet mehr Aufwand. Parabolspiegel gibt es zwar
als Offset-Sat-Schüssel mittlerweile für relativ wenig Geld und ein
Loop-Strahler/ eine Patch-Antenne ist relativ einfach zu erstellen, dafür hat
man eine relativ hohe Windlast, was bei entsprechendem Wind auf den (nicht
nur bayrischen) Bergen schnell zum Problem wird.
Beide Antennensystem erzielen den Gewinn über eine Verkleinerung des
vertikalen und horizontalen Öffnungswinkel. Idealerweise hat aber die
BBT-Antenne einen kleinen vertikalen und einen möglichst großen
horizontalen Öffnungswinkel, damit möglichst ein großer Winkel abgedeckt
wird. Eine Doppelachtantenne ist recht schnell aufgebaut, aber über 10dBD
Gewinn mit einen Reflektorblech lassen sich dort nicht erreichen.
Alternative ist der Gruppenstrahler. Josef Reithofer, DL6MH, hat in zwei
Bücher [1]/[2] diesen Antennentyp für die Bänder zwischen 70cm und 13cm
beschrieben.
Das Grundelement ist hier ein Ganzwellendipol, bei Speisung in der Mitte ist
dieser hochohmig (300-1000Ohm). Die Impedanz der einzelnen Strahler lässt
sich durch den Schlangheitsgrad in einem weiten Bereich einstellen. Stockt
man nun mehrere dieser Ganzwellendipole vertikal übereinander und wählt den
Abstand lambda/2 und überkreuzt die 2-Draht-Speiseleitung, so werden die
Ganzwellendipole gleichphasig gespeist. Durch das Parallelschalten der
Ganzwellendipole sinkt die Impedanz der Antennen. Wählt man die Impdanz
entsprechend, lässt sich diese Antennen relativ einfach über einen 4:1 Balun
an 50 Ohm anpassen. Als Reflektor nimmt man entweder ein engmaschiges Gitter
(lambda/20) oder ein Lochblech. Die mechanischen Abmessungen der
Strahler sind nicht sehr kritisch, da diese Antennenbauform breitbandig ist.
Das Widerstandsschema lässt sich an Hand der Grafik recht einfach erklären.
Bei der Antenne handelt es sich um zwei Vierer-Gruppenantenne, die gestockt
werden. Die Antenne wird über einen lambda/2 Umwegleitung gespeist, damit
erreicht man in der Mitte eine Impedanz von 200Ohm. Anschliesend erfolgt für
beide Gruppen ein lambda/4 Trafo (Z0=sqrt(Z1*Z2)), der die 400Ohm (400Ohm //
400Ohm sind 200 Ohm) auf die Impedanz der 2 Gruppen transformiert (400 Ohm).
Die Impedanz der Ganzwellendipole (800Ohm) ist dann doppelt so groß wie die
der einzelnen Gruppe (400Ohm). Das Beispiel entspricht dem 23cm
Gruppenstrahler.
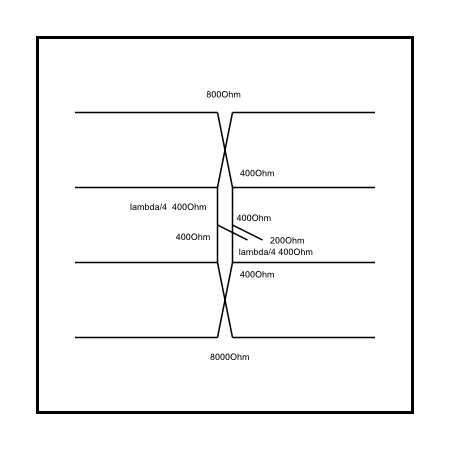
Die Impedanz der lamda/4 Transformationsleitung hängt nur vom Verhältnis Abstand (D) der Drähte zu Durchmesser (d) ab. Berücksichtigen muss man ausserdem , das bei einem Ganzwellendipol der Verkürzungsfaktor stärker vom Schlangheitssgrad abhängt, als bei einem lambda/2 Dipol.
Josef Reithofer hat in [1] zwei Kombinantennen für 23cm/13cm beschrieben, eine 23cm 6-Element/ 13cm 8-Element-Gruppe und eine 23cm 8-Element/ 13cm 12-Element-Gruppe. Letztere habe ich nachgebaut, allerdings ist die 23cm Gruppe in [1] nicht mittig gespeist, in meiner Ausführung habe ich dies entsprechend geändert und mittig gespeist. Die 12 Element Gruppe besteht wiederum aus zwei 6-Element-Gruppen, die parallel geschaltet werden.

Das Bild zeigt den 23cm/13cm Gruppenstrahler auf einem gemeinsamen Reflektor (500mmx500mm), die benötigten Teile stammen alle aus dem Baumarkt, bzw. aus dem Bastelbedarf.
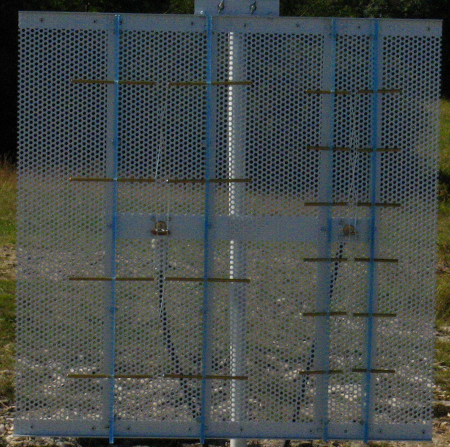
23cm Gruppe:
Der Abstand der Einspeisung beträgt 170mm vom Rand.
Schlankheitsgrad 23cm/4mm = 57,5, Impedanz ca. 800Ohm, jede der Teilgruppen
kommt auf ca. 400Ohm, die lambda/4 Transformatorleitung muss ebenfalls ca.
400 Ohm haben, aus dem D/d-Verhältnis und 1mm AgCu-Draht ergibt sich ein
Abstand der Elemente untereinander von ca 13mm.
Die einzelnen Elemente sind auf 4mm Messingröhrchen gefertig, die Länge
beträgt 99mm (V=0,86), der Abstand zwischen den Strahlerebenen 115mm, der Abstand
zum Reflektor 50mm.
13cm Gruppe:
Der Abstand der Einspeisung beträgt 105mm vom Rand.
Schlankheitsgrad 13cm/4m = 32,5, Impedanz ca. 700 Ohm, jede der Teilgruppen kommt
auf ca. 230Ohm, die lambda/4 Transformatorleitung muss ca. 300 Ohm haben, aus dem
D/d-Verhältnis und 1mm AgCu-Draht ergibt sich ein Abstand der Leitung untereinander
von ca. 6mm.
Die einzelnen Elemente sind auf 4mm Messingröhrchen gefertig, die Länge
beträgt 52mm (V=0,79), der Anstand zwischen den Strahlerebenen 65mm, der Abstand zum
Reflektor 37mm.
Die Elemente werden durch Plexiglasstreifen gehalten, diese sind über Winkel
mit dem Rahmen und dem Reflektorblech verschraubt, die Semi-Rigid-N-Buchsen
sind mit einem Flachmaterial befestigt. Die Bohrungen für die Befestigung der
Elemente werden entsprechend so gebohrt, das diese stramm darin sitzen, mittels
eines Richtkopplers und eines Messenders wird der Abstand auf minimalen Rückfluß
eingestellt. Danach werden die Elemente mit dem Plexiglas verklebt.
In der Simulation liefert die 8-Element-Gruppe ca 12dBD Gewinn bei einem
horizontalen Öffnungwinkel von 120°, die 12 Element-Gruppe ca. 13.5dBD
Gewinn bei gleichem horizontalen Öffnungwinkel, das V/R-Verhältnis ist
bessser als 20dB. Die gemessene Anpassung lag jeweils besser als -20dB
bei über 60MHz auf 23cm, die 13cm Gruppe überstreicht das gesamte
Amateurfunkband.

23cm 8 Element Gruppenstrahler |

13cm 12 Element Gruppenstrahler |
Einschränkungen und Hinweise:
Die Antenne bzw. die offene 2 Drahtleitung sind recht witterungsanfällig,
daher muss für eine Dauerbetrieb ein wetterfestes und Hf-durchlässiges
Random aufgesetzt werden.
Die einzelnen Ebenen sind grundsätzlich mit einem lambda/2 Abstand
angebracht, dies ergibt jedoch nicht den optimalen Gewinn, der Abstand liegt
zwischen 0,65 und 0,80 Lambda in Abhängigkeit von der Anzahl der Ebenen.
Jedoch ist bei einem solchen Abstand die Verlegung der Phasenleitung
kompliziert, daher ist der Kompromiss weniger Gewinn und einfache Bauweise
akzeptabel.
Je mehr Ebenen zum Einsatz kommen, desto größer wird der Einfluß der
Laufzeiten auf den 2-Draht-Speiseleitungen, daher lässt sich der Gewinn
nur bedingt steigern.
Die Simulation der Antennen wurden mit 4nec2 erstellt, die Werte entsprechend
denen, die DL6MH in dem Buch angibt.
Literatur:
[1] Josef Reithofer, DL6MH, UHF-Amateurfunk-Antennen, Franzis-Verlag RPB-Band 30
[2] Josef Reithofer, DL6MH, Praxis der MIkrowellenantennen, UKW-Berichte
[3] Rothammel,Antennenbuch, 10. Auflage, Militärverlag der DDR
